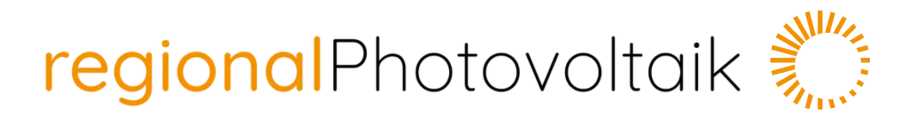Zuletzt aktualisiert am 26. April 2025
Viele suchen nach Informationen zur Einspeisevergütung 2025 Tabelle. Im Jahr 2025 ändern sich die Fördersätze für Solaranlagen. Unser Artikel zeigt klar, wie diese Änderungen aussehen.
💡 Zusammenfassung
- Im Jahr 2025 ändern sich die Fördersätze für die Einspeisung von Solarstrom deutlich, wobei kleine Anlagen bis 10 kWp im ersten Halbjahr zwischen 7,94 Cent und 12,60 Cent pro Kilowattstunde erhalten.
- Das Solarspitzengesetz 2025 führt zu neuen Vergütungssätzen ab dem 1. Februar 2024 und verlangt eine Reduzierung der Einspeiseleistung auf 60% ohne intelligentes Messsystem.
- Eigenverbrauch wird 2025 finanziell attraktiver als die Einspeisevergütung, mit Einsparungen von bis zu 2.051 Euro jährlich im Vergleich zu nur 425 Euro durch Einspeisung ins Netz.
- Die Entwicklung der Einspeisevergütung zeigt von 2000 bis 2025 große Schwankungen, mit einem Höhepunkt im Jahr 2004 und einem deutlichen Rückgang bis 2022, gefolgt von einer Erholung bis 2025.
- Zukünftige Änderungen könnten die Vergütung bei negativen Strompreisen aussetzen und betonen die Bedeutung der technischen Voraussetzungen und des Marktprämienmodells für Betreiber von Photovoltaikanlagen.
und sparen Sie bis zu 30%.
- Schnell in 2 Minuten Anfrage stellen.
- Erhalte bis zu 4 Angebote von Fachbetrieben in deiner Region.
- Übernahme von Förderanträgen für maximale Zuschüsse.
- Kostenlos & Unverbindlich inkl. Beratung.

Aktuelle Höhe der Einspeisevergütung im Jahr 2025
📅 Einspeisevergütung – Februar bis Juli 2025
| Anlagengröße (kWp) | Teileinspeisung (Cent/kWh) | Volleinspeisung (Cent/kWh) |
|---|---|---|
| bis 10 | 7,94 | 12,60 |
| 10 – 40 | 6,88 | 10,56 |
| 40 – 100 | 5,62 | – |
📅 Einspeisevergütung – August 2025 bis Januar 2026
| Anlagengröße (kWp) | Teileinspeisung (Cent/kWh) | Volleinspeisung (Cent/kWh) |
|---|---|---|
| bis 10 | 7,87 | 12,48 |
| 10 – 40 | 6,81 | 10,46 |
| 40 – 100 | 5,56 | – |
Im Jahr 2025 haben sich die Vergütungssätze für die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen deutlich geändert. Diese Anpassung betrifft sowohl die Einspeisevergütung für zusätzlich erzeugten Strom als auch die Vergütung für Strom, der vollständig ins Netz eingespeist wird.
Einspeisevergütung bei Überschusseinspeisung
Die Einspeisevergütung belohnt Besitzer von Solarmodulen, wenn sie überschüssigen Solarstrom ins Netz geben. Für kleine Photovoltaikanlagen bis 10 Kilowatt peak (kWp) liegt diese Vergütung zwischen Februar und Juli 2025 bei 7,94 Cent pro Kilowattstunde (kWh).
Anlagen, die zwischen 10 kWp und 40 kWp groß sind, erhalten 6,88 Cent pro kWh. Größere Systeme bis 100 kWp bekommen 5,62 Cent pro kWh.
Diese Fördersätze sinken leicht in der zweiten Jahreshälfte. Ab August 2025 bis Januar 2026 zahlt man für Anlagen bis 10 kWp 7,87 Cent pro kWh. Für die mittelgroßen Anlagen von 10 bis 40 kWp sind es dann 6,81 Cent pro kWh und für die größten betrachteten Anlagen bis 100 kWp sinkt der Satz auf 5,56 Cent pro kWh.
Solche Vergütungen machen es attraktiv, Strom aus erneuerbaren Quellen zu produzieren und unterstützen das Ziel einer nachhaltigeren Energieversorgung.
Einspeisevergütung bei Volleinspeisung
Bei Volleinspeisung geben Besitzer von Photovoltaikanlagen den gesamten produzierten Strom an das Netz ab. Sie bekommen dafür eine Vergütung. Im Zeitraum von Februar bis Juli 2025 liegt diese Vergütung für Anlagen bis 10 kWp bei 12,60 Cent pro kWh.
Für größere Anlagen zwischen 10 und 100 kWp zahlt man ihnen 10,56 Cent pro kWh. Ab August 2025 ändert sich der Betrag leicht. Anlagen bis 10 kWp erhalten dann 12,48 Cent für jede kWh, und Anlagen von 10 bis 100 kWp bekommen 10,46 Cent pro kWh.
Diese Tarife gelten bis Januar 2026. Betreiber profitieren so von einer festen Einnahmequelle durch die erneuerbaren Energien.
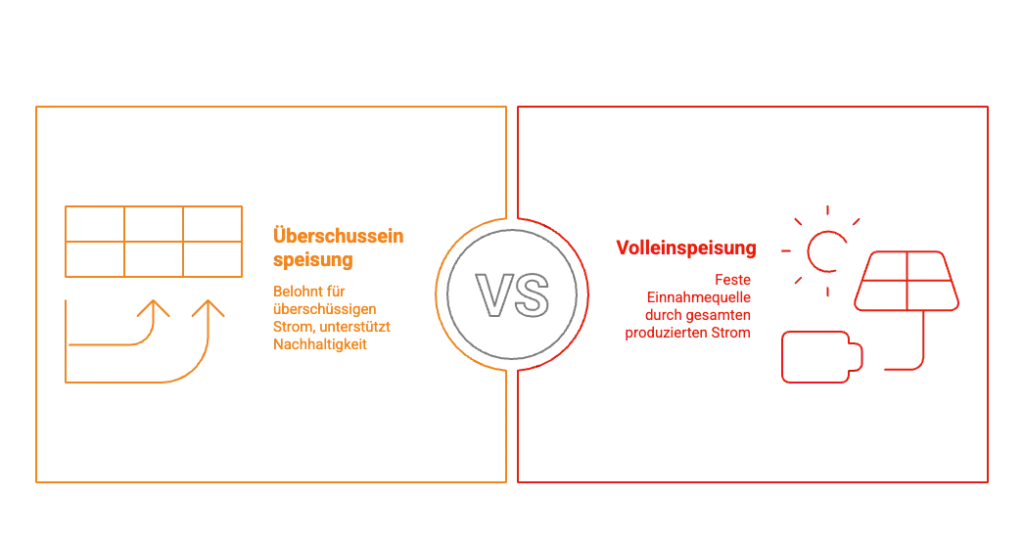
Solarspitzengesetz 2025
Das Solarspitzengesetz 2025 bringt wichtige Änderungen für Betreiber von Photovoltaikanlagen. Ab dem 1. Februar 2024 gelten neue Einspeisevergütungssätze. Die Anpassungen fördern die Nutzung erneuerbarer Energien und wirken sich auf die Vergütung aus.
Betreiber müssen jetzt ihre Einspeiseleistung auf 60% reduzieren, wenn sie kein intelligentes Messsystem einsetzen.
Zusätzlich müssen Anlagen über 750 kWp ihren Strom direkt am Markt verkaufen. Dies zwingt größere Produzenten zu einem aktiveren Energiemanagement. Die Vergütung sinkt alle sechs Monate um 1%, was den Einsatz von alternativen Energien weiter vorantreiben soll.
Das Gesetz zielt darauf ab, die Energieerzeugung nachhaltiger zu gestalten und den Eigenverbrauch von Solarenergie zu erhöhen.
Tabelle: Einspeisevergütung 2025
Die Tabelle zeigt die verschiedenen Fördersätze für Solaranlagen im Jahr 2025 und hilft, Ihre möglichen Einnahmen zu verstehen.
Fördersätze für PV-Anlagen bis 10 kWp
Hier sehen wir uns die Fördersätze für Photovoltaikanlagen bis 10 kWp im Jahr 2025 an. Für solche Anlagen gelten folgende Vergütungssätze:
| Zeitraum | Teileinspeisung | Volleinspeisung |
|---|---|---|
| Februar bis Juli 2025 | 7,94 Cent/kWh | 12,60 Cent/kWh |
| August bis Januar 2026 | 7,87 Cent/kWh | 12,48 Cent/kWh |
Besitzer von Photovoltaikanlagen bis 10 kWp erhalten also je nachdem, wie viel Strom sie ins Netz einspeisen, unterschiedliche Vergütungen. Von Februar bis Juli 2025 liegen diese Sätze bei 7,94 Cent pro kWh für Teileinspeisung und 12,60 Cent pro kWh für Volleinspeisung. Ab August 2025 bis Januar 2026 sinken diese Sätze leicht auf 7,87 Cent pro kWh für Teileinspeisung und 12,48 Cent pro kWh für Volleinspeisung.
Fördersätze für PV-Anlagen von 10 kWp bis 40 kWp
Im Jahr 2025 ändern sich die Fördersätze für Solaranlagen. Dies betrifft auch Anlagen mit einer Leistung zwischen 10 kWp und 40 kWp. Für diese Größe von Anlagen sind die Fördersätze besonders wichtig. Sie helfen den Betreibern, ihre Investitionen schneller zurückzuerhalten.
| Zeitraum | Fördersatz |
|---|---|
| Februar bis Juli 2025 | 6,88 Cent/kWh |
| August bis Januar 2026 | 6,81 Cent/kWh |
Diese Tabelle zeigt, wie sich die Fördersätze im Laufe des Jahres leicht verändern. Von Februar bis Juli erhält man 6,88 Cent pro kWh für eingespeisten Strom. Ab August sinkt der Satz leicht auf 6,81 Cent. Diese Änderungen sind wichtig für die Planung und Kalkulation der Erträge aus Solaranlagen.
Solche finanziellen Anreize fördern den Ausbau erneuerbarer Energien. Sie machen es attraktiver, in Photovoltaik zu investieren. Mit diesen Fördersätzen unterstützt der Staat nicht nur den Umweltschutz, sondern auch die Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen für kleinere Unternehmen und Privathaushalte.
Fördersätze für PV-Anlagen über 40 kWp
Für Besitzer großer Photovoltaik-Anlagen, die eine Kapazität von über 40 Kilowattpeak (kWp) haben, sind die Fördersätze besonders wichtig. Diese Sätze bestimmen, wie viel Geld sie für den Strom bekommen, den sie ins Netz einspeisen. Hier sehen Sie, wie diese Fördersätze im Jahr 2025 aussehen:
| Zeitraum | Fördersatz für Teileinspeisung (Cent/kWh) |
|---|---|
| Februar bis Juli 2025 | 5,62 |
| August bis Januar 2026 | 5,56 |
Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, ändern sich die Fördersätze im Laufe des Jahres. Von Februar bis Juli 2025 erhalten Anlagenbesitzer 5,62 Cent für jede Kilowattstunde, die sie einspeisen. Von August bis Januar 2026 sinkt der Satz leicht auf 5,56 Cent pro Kilowattstunde.
Diese Fördersätze sind entscheidend für die Berechnung der Rentabilität von Photovoltaik-Anlagen. Sie helfen Besitzern, ihre Einnahmen zu planen. Große Anlagen haben oft hohe Installationskosten. Daher ist es wichtig, die Einspeisevergütung genau zu kennen. So können Besitzer sicherstellen, dass sich ihre Investition lohnt.
Praxisbeispiele für die Berechnung der Einspeisevergütung
Praxisbeispiele zeigen, wie man die Einspeisevergütung berechnet. In diesen Beispielen nutzen wir Daten von PV-Anlagen und aktuellen Fördersätzen.
📋 Beispiel 1: Überschusseinspeisung
Die Überschusseinspeisung ermöglicht es, zusätzlichen Strom ins Netz einzuspeisen. Ein Betreiber, der eine PV-Anlage mit 15 kWp hat, kann dafür eine Vergütung von 7,75 Cent pro kWh erhalten.
Bei dieser Methode nutzen Hausbesitzer den eigenen erzeugten Strom zuerst für den Eigenverbrauch. Überschüssige Energie fließt dann in das Stromnetz.
Diese Art der Einspeisung ist wirtschaftlich sinnvoll. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) fördert diese Praxis, um die Nutzung von grünem Strom zu steigern. Zudem ist ein Zweirichtungszähler notwendig, um den eingespeisten und den verbrauchten Strom zu messen.
Solche Maßnahmen unterstützen auch die Ziele der Energiewende.
📋 Beispiel 2: Volleinspeisung
Bei der Volleinspeisung speisen Betreiber ihre gesamte Stromproduktion ins Netz ein. Sie erhalten dafür eine festgelegte Einspeisevergütung. Im März 2025 liegt dieser Satz bei 10,79 Cent pro Kilowattstunde.
Dies gilt für Anlagen mit einer Leistung von 90 kWp. Solche Anlagen bieten Vorteile durch stabile Einnahmen. Betreiber profitieren von der Vergütung, während der Strom in die Strombörse gelangt.
Das erneuerbare-energien-gesetz (EEG) regelt diese Vergütung. Fördersätze nach dem EEG 2023 fördern die Nutzung erneuerbarer Energien. Auch intelligente Messsysteme, wie Smart Meter, helfen bei der Abrechnung.
Diese Technologien unterstützen die Überwachung des Stromverbrauchs und der Einspeisung. Volleinspeisung bleibt damit ein wichtiger Bestandteil des Marktes für erneuerbare Energien.
- Erhalten Sie bis zu 4 Angebote von Fachbetrieben Ihrer Region.
- Lassen Sie sich unverbindlich von echten Experten beraten und sparen Sie bis zu 30%.
- Kostenloser Förder-Check
Entwicklung der Einspeisevergütung von 2000 bis 2025
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) trat im Jahr 2000 in Kraft und veränderte die Energiemärkte. Im Jahr 2004 erreichte die Einspeisevergütung ihren Höchststand mit 57,40 Cent pro Kilowattstunde (kWh).
Dieser hohe Betrag sorgte dafür, dass viele Investoren in erneuerbare Energien, wie Solar- und Windenergie, einsteigen wollten.
Bis 2022 fiel die Vergütung jedoch auf einen Tiefstand von 6,24 Cent pro kWh. Die EEG-Novelle von 2023 brachte eine Wende. Sie ermöglichte einen Anstieg der Einspeisevergütung bis 2025 auf etwa 7,95 Cent pro kWh für Photovoltaikanlagen bis 10 kWp.
Diese Entwicklung zeigt die Schwankungen der Einspeisevergütung über die Jahre und die Auswirkungen verschiedener Förderprogramme auf den Markt.
Eigenverbrauch versus Einspeisevergütung: Was lohnt sich 2025?
Eigenverbrauch lohnt sich 2025 mehr denn je. Ein durchschnittlicher Strompreis von 41,02 Cent pro Kilowattstunde treibt die Kosten für Verbraucher in die Höhe. Bei einem Stromverbrauch von 5.000 kWh pro Jahr sparen Nutzer durch Eigenverbrauch bis zu 2.051 Euro jährlich.
Diese Einsparung ergibt sich vor allem aus der Nutzung selbst erzeugter Energie.
Die Einspeisevergütung bietet hingegen weniger finanzielle Vorteile. Nutzer erhalten nur 425 Euro jährlich für die Einspeisung ins Netz. Eigenverbrauch bringt den Vorteil von zusätzlichen 1.626 Euro durch Vermeidung von Einkaufspreisen für den Netzstrom.
Die Wahl zwischen Eigenverbrauch und Einspeisevergütung hängt stark von den individuellen Umständen ab, aber der Eigenverbrauch steht klar im Vordergrund.
Fazit
Die Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen bringt klare Vorteile. Betreiber von Anlagen, die zwischen dem 1. Februar 2025 und dem 31. Juli 2025 in Betrieb genommen werden, erhalten Förderungen.
Diese variieren bei Überschusseinspeisung zwischen 7,94 und 5,62 Cent pro Kilowattstunde. Bei Volleinspeisung liegen die Sätze zwischen 12,60 und 10,56 Cent pro Kilowattstunde.
Zukünftige Änderungen könnten die Vergütung bei negativen Strompreisen aussetzen. Auch eine Zahlung auf Basis der Investitionskosten könnte kommen. Betreiber müssen zudem beachten, dass die Einspeisevergütung für 20 Jahre garantiert ist.
Um eine Förderung optimal zu nutzen, sollten sie sich über technische Voraussetzungen und das Marktprämienmodell informieren.
🔋 Unser PV-Speichergrößen Rechner
Häufig gestellte Fragen
Die Einspeisevergütung ist eine finanzielle Förderung für Besitzer von Photovoltaikanlagen. Sie erhalten für jede Kilowattstunde Strom, die sie ins öffentliche Netz einspeisen, eine Vergütung. Diese ist für 20 Jahre garantiert und hängt von Faktoren wie der Anlagengröße und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme ab. Eigenverbrauch kann die Vergütung reduzieren, bringt aber Einsparungen bei den Stromkosten.
Die Einspeisevergütung ändert sich im Jahr 2025 je nach Anlagengröße und Einspeiseart. Bei Überschusseinspeisung erhalten Anlagen bis 10 kWp zwischen 7,94 Cent (Februar – Juli) und 7,87 Cent (August – Januar 2026) pro kWh. Bei Volleinspeisung liegt die Vergütung für die gleiche Anlagengröße bei 12,60 Cent bzw. 12,48 Cent pro kWh. Anlagen zwischen 10 kWp und 40 kWp bekommen zwischen 6,88 und 6,81 Cent (Überschusseinspeisung) sowie 10,56 bis 10,46 Cent (Volleinspeisung).
Das Solarspitzengesetz 2025 bringt neue Vergütungssätze und fordert eine Reduzierung der Einspeiseleistung auf 60 %, falls kein intelligentes Messsystem verwendet wird. Zudem müssen Anlagen über 750 kWp ihren Strom direkt am Markt verkaufen. Die Vergütung sinkt alle sechs Monate um 1 %, um den Markt weiter zur Nutzung erneuerbarer Energien zu motivieren.
Ja, Eigenverbrauch ist 2025 finanziell vorteilhafter. Da der Strompreis bei etwa 41,02 Cent pro kWh liegt, kann man durch Eigenverbrauch bis zu 2.051 Euro pro Jahr sparen. Im Vergleich dazu bringt eine Einspeisung ins Netz nur rund 425 Euro ein. Das bedeutet, dass sich der Eigenverbrauch stärker lohnt, da er den teuren Netzstrom ersetzt.
Ja, zukünftige Änderungen könnten die Einspeisevergütung bei negativen Strompreisen aussetzen. Zudem gibt es Überlegungen, die Förderung stärker an Investitionskosten zu koppeln. Betreiber sollten sich daher über technische Voraussetzungen und das Marktprämienmodell informieren, um ihre Förderung bestmöglich zu nutzen.
✍️ Geschrieben von:

Christian, ein erfahrener Experte mit über zehn Jahren Erfahrung im Bereich Photovoltaik und erneuerbare Energien, ist eigentlich gelernter Dachdecker. Mit seinem fundierten Wissen über Solartechnologie und praktische Erfahrung bietet er wertvolle Einblicke und praxisnahe Ratschläge. Seine Expertise erstreckt sich auf die Planung und Umsetzung von Solaranlagen sowie auf das Verständnis für aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich erneuerbarer Energien.